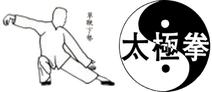Taiji heute
Vortrag von Dr. Christian Unverzagt auf dem Taiji-Tag in Bad Schönborn, Juni 2007

Liebe Taiji-Freunde, Interessierte - und alle anderen!
I.
Wir sehen Taiji im Aufwind, und so könnte man eine positive Bilanz seiner Entwicklung in unserem Land und einen glanzvollen Ausblick erwarten. Taiji „boomt“: Es gibt immer mehr einigermaßen
erfahrene Taiji-Übende, auch chinesische Lehrer kommen ins Land, die Volkshochschulen haben seit Jahren Taiji im Angebot, Krankenkassen bezahlen wieder (!) den ein oder anderen Kurs, und es
gründen sich Dachverbände. Immer mehr Menschen wissen oder glauben zu wissen, worum es sich handelt.
Ein Jubelvortrag wie auf einer Aktionärs- oder Parteiversammlung wäre vielleicht unserer wirtschaftswütigen Zeit, in der jedes Mehr gut zu sein scheint, gemäß. Aber unter kultivierten Menschen
gilt Schönrednerei oder die propagandistische Beweihräucherung der eigenen Sache immer noch als Makel. Außerdem wäre ein solcher Vortrag nicht im Geist des Taiji, das ja nie nur aus Yang besteht,
sondern mit seinem Yin auch eine Schattenseite hat. Diese wollen wir nicht verschweigen, wenn es ums Schattenboxen geht. Sie werden also nicht zum Ohrenzeugen einer Lobpreisung im Rahmen von so
etwas wie einer „Exzellenzinitiative Taijiquan“. Stattdessen lassen wir den Geist, der stets verneint, zu Wort kommen:
„Und das mit Recht;“ wenn ich zitieren darf, „denn alles, was entsteht,
Ist wert, daß es zugrunde geht.“
Das zumindest meinte ein Geist, vor dessen Größe sich auch die Taiji-Übenden getrost verneigen können. Was ich damit meine, wenn ich diesen Satz zitiere, ist gewiss nicht, dass das Taiji
untergehen sollte, sondern dass wir einen Blick auf sein Werden werfen sollten – in dem immer Entstehen und Vergehen ist. „Taiji heute“ lässt sich nicht ohne einen Blick auf Taiji gestern und
vielleicht einen Ausblick auf Taiji morgen verstehen.
II.
Taiji ist entstanden, ist somit am Vergehen – und am Werden; nicht erst, seit es in den Westen gelangt ist, sondern auch schon in China. Noch vor hundert Jahren wusste nicht nur im Westen niemand
von Taiji, auch in China war es kaum bekannt. Das hat mit seinem Charakter als Kampfkunst zu tun.
Kampfkünste hatten in China traditionell drei Orte: die Kaserne, das Kloster und den Klan. Im Militär wurden die 18 Waffengattungen gepflegt. In Klöstern wie dem von Shaolin übten sich Mönche in
Kampfkunstdisziplinen, z.T. um ihren Körper für die langen Meditationen zu stärken, z.T. um sich bei Wanderungen gegen Räuberbanden verteidigen zu können; z.T aber auch, um von ihren Äbten als
Legionäre ausgeliehen zu werden. In Dörfern oder Weilern trainierten Klane ihre Mitglieder, um sich bei Fehden oder in unruhigen Zeiten verteidigen zu können.
Zu diesen Orten der Pflege und Entwicklung von Kampfkünsten gesellten sich zwei Orte, an denen sie sich offenbaren konnten: zum einen der Traum, zum anderen die Natur, der Kulturheroen oder eben
Kampfkunsthelden Bewegungsprinzipien des Kampfes ablauschen und abschauen konnten. Für Zhang Sanfeng, den legendären Begründer des Taijiquan, sind beide Versionen überliefert. Einer dieser
Versionen zufolge soll er die Prinzipien des Taijiquan im Traum von dem Kriegsgott Zhen Wu mitgeteilt bekommen haben, als er einen Wald voller Räuber zu durchqueren hatte. Diese konnte er dann am
nächsten Tag alle mit bloßer Hand erschlagen. Etwas weniger martialisch ist die andere Ursprungslegende, wonach er den Kampf eines Kranichs mit einer Schlange beobachtete und fasziniert davon
war, wie die Schlange sich mit ihren runden, ausweichenden Bewegungen der kraftvollen Schnabelhiebe des Kranichs erwehren konnte.
Historisch verifizierbar ist weder die eine noch die andere Legende. Der historisch belegbare Zhang Sanfeng, ein Daoist der Song-Zeit (960–1279), wird in dem Eintrag, der ihm in den Annalen der
Dynastie gewährt wurde, ohne jede Verbindung zu Kampfkünsten abgehandelt. Das sagt zwar nicht, dass es sie nicht gab, aber dass wir keine historische Quelle dazu haben.
Historisch nachvollziehbar kommt Taijiquan aus Chenjiagou, dem Dorf des Chen-Klans. Bei der Frage, wie es dorthin kam, werden wir wieder über die Geschichte hinaus an Legenden verwiesen. Relativ
gesichert ist noch, dass ein General aus der Chen-Familie (Chen Wanting) sich bei dem Dynastiewechsel im 17. Jahrhundert in sein Heimatdorf zurückzog und dort seine Erkenntnisse zur Kampfkunst
ausarbeitete. Bei der Frage nach den Quellen, aus denen er wiederum geschöpft hat, tauchen weitere ungesicherte Namen wie Wang Zongyue und wiederum Zhang Sanfeng auf.
Dass die Geschichte sich in farbigen Legenden auflöst, gehört zu den Kampfkünsten dazu wie der Bergnebel zu einer chinesischen Landschaftsmalerei. Aber all diese Geschichten wären vielleicht
versiegelt geblieben, mehr noch: das Taijiquan wäre vielleicht nie in China, geschweige denn im Westen, bekannt geworden ohne Yang Luchan (1799–1872), den Begründer des Yang-Stils. Dieser Mann
brachte es zu einer erstaunlichen Karriere, die er als Leibeigener begann und als Lehrer der Söhne des Kaisers beendete. Ihm, dem Familienfremden, gelang es durch seinen Eifer und seine
Befähigung, die Kampfkunst der Chen-Familie zu erlernen. Er trug das Taijiquan – das damals übrigens noch nicht diesen Namen trug – aus Chenjiagou heraus, erst in seinen Heimatort, dann in die
Hauptstadt Peking, wo er sich mit der von ihm umgestalteten Kampfkunst den Beinamen „der Unbesiegbare“ erwarb. Das alles geschah erst vor rund 150 Jahren.
Nach 1911, d.h. nach der Abdankung des letzten Kaisers, entstanden in China neue Formen der Öffentlichkeit. Das bedeutete auch für das Taijiquan einen ungeahnten Entwicklungsschub. Zuerst in
Peking und Shanghai, dann nach und nach in anderen Städten, entstanden Schulen, in denen die großen Meister und ihre Meisterschüler unterrichteten. Seit dieser Zeit betonte man die
gesundheitsfördernden Wirkungen des Taijiquan. Es gab zwar noch keine Krankenkassen, von denen man sich Subventionen versprechen durfte, aber
a) angesichts von Feuerwaffen schien der Kampfkunstaspekt des Taijiquan in gewaltsamen Auseinandersetzungen sinnlos geworden;
b) empfand sich China als eine „kranke“, gedemütigte Nation. Verlorene Kriege und Millionen von Opiumabhängigen als Ergebnis der von den Briten in einer ersten Globalisierungsstrategie
betriebenen Drogenpolitik hatten zu einem Gefühl der Schwäche und Demütigung geführt. Taijiquan wurde nach dem Motto mens sana in corpore sano als Rezept zur Gesundung der chinesischen
Bevölkerung gepriesen.
c) Außerdem blieben alte Kampfkünstler, aus Erfahrung klug, vorsichtig bei der öffentlichen Verbreitung ihrer Künste. Unberechenbare Machthaber und fanatisierte Massen hatte es in der
chinesischen Geschichte auch schon vor Maos Kulturrevolution gegeben.
Später, im kommunistischen China, diente dieses „Gesundheits-Image“ dem Taijiquan, wenn auch auf zwiespältige Weise. Während andere Kampfkünste v.a. wegen ihrer dem Staat suspekten
Loyalitätsverhältnisse von Lehrer und Schülern verboten wurden, verordnete man eine abgespeckte Taiji-Form für alle – die in einer kontrollierten Öffentlichkeit gelehrt wurde. Auf Straßen und
Fabrikhöfen sah man Hunderte und Tausende die Bewegungen eines vorgesetzten Lehrers imitieren. Diese Form, die sog. Peking-Form, gibt es immer noch, auch im Westen ist sie relativ populär. Maos
Taiji-Verordnung hat also mit Sicherheit zur Verbreitung des Taijiquan beigetragen.
An dieser Verbreitung wäre das Taiji allerdings beinahe zugrunde gegangen. Zum einen rief sie den Widerwillen gegen Verordnetes hervor, zum anderen blieb das Niveau bei dieser Art des Unterrichts
niedrig. „Zum Glück“ hatten die Chinesen Erfahrung mit Verboten und ihrer Umgehung. (Viel von der Geheimniskrämerei, die auch heute noch um Kampfkünste betrieben wird, hat damit zu tun, dass
Gruppen, in denen sie praktiziert wurden, immer wieder – und nicht immer zu Unrecht – umstürzlerischer Gedanken verdächtigt und verfolgt wurden.) Auch weiterhin gibt es Meister im Verborgenen,
die die Kunst nur an einzelne oder ganz wenige Interessierte weitergaben. Taiwan und die auslandschinesischen Gemeinden, namentlich in Südostasien, aber auch in den USA, wurden ebenfalls zu
Horten, an denen die Kunst überlebte. Mittlerweile ist alles wieder viel freier in China. Das Üben von Kampfkünsten ist wieder erlaubt, auch wenn staatliche Institutionen versuchen, v.a. über
Zertifikate und Förderung, Einfluss zu nehmen.
Es lässt sich eine deutliche Parallele zur jetzigen Verbreitung des Taiji im Westen erkennen. Auch bei uns ist die Legitimation für die Verbreitung des Taijiquan vor allem sein
gesundheitsfördernder Aspekt; und auch hier versuchen sich mittlerweile Institutionen zu etablieren, die durch Steuerung von Fördermitteln Einfluss auf die Imagebildung nehmen.
Wenn wir uns die relativ kurze Geschichte des Taiji im Westen anschauen, so sehen wir bereits einen deutlichen Imagewandel. Hatten die Pioniere der Kampfkünste nach dem Zweiten Weltkrieg v.a.
japanische Stile nach Europa und Amerika gebracht, so waren es in den 70er Jahren eher die Hippies und die Kulturkritik der Ethnowelle, die den Westen auf etwas breiterer Basis mental dem Osten
öffnete. Taiji mit seiner Ausstrahlung von Ruhe, Sanftheit und einer anderen Körperlichkeit versprach eine verborgene, uralte chinesische Weisheit, für die der Westen nun reif schien. Chinesische
Meister in den USA, die zuvor hauptsächlich in ihren chinesischen Gemeinschaften tätig waren, begannen allmählich „Ausländer“ zu unterrichten.
Inzwischen herrscht ein reger Austausch zwischen den Kontinenten, der Chancen und Gefahren birgt. Und so tauchte mit der wachsenden Popularität von Taiji auch das Bedürfnis nach
„Qualitätssicherung“ auf, die einer unkontrollierten Geschäftemacherei den Riegel vorschieben soll. Es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass auch gut gemeinte Konzepte, die einer
Institutionalisierung bedürfen, nicht vor ihrer „Verbrüsselung“ gefeit sind und man am Ende auch bei den „qualitätssichernden“ Maßnahmen nicht immer sicher sein kann, ob sie nicht einer
Cliquenwirtschaft und der Aufteilung von Pfründen dienen.
III.
Wenn wir uns in Deutschland umsehen, können wir feststellen, dass es hier mittlerweile Vertreter aller Stile gibt; und dass es in jedem Stil Fortgeschrittene gibt, die bei Meistern in China,
Taiwan oder in auslandschinesischen Gemeinden gelernt haben. So wie unter Chinesen auch – und so wie es dem Taiji entspricht – betont jede Überlieferungslinie und jede Schule unterschiedliche
Aspekte der Kunst. Taiji lebt nicht von Techniken, die man identisch erlernen könnte, sondern von einer körperlichen und mentalen Integration seiner Formen in die jeweilige Persönlichkeit.
Insofern hat das unendlich ausdeutbare Wesen des Taiji gute Chancen, seiner Vereinheitlichung und Vereinnahmung erfolgreich zu entgehen. Dennoch scheint es in seinem Werden permanent von zwei
Tendenzen bedroht:
a) Einerseits wird sein Name immer wieder für übereilte Ergänzungen und „Verbesserungen“ nach den Anforderungen einer genehmen und nützlichen Image-Bildung missbraucht – bis die Sache unkenntlich
ist. Gerade neulich bekam ich eine Mail mit der Nachricht, dass in einem Hamburger Fitness-Studio eine ganz neue, verbesserte Art des Taiji entwickelt worden sei. Fast gleichzeitig kam aus
Amerika die Nachricht, dass ein indischer US-Bürger Yoga-Übungen beim Patentamt angemeldet hat – wogegen jetzt die indische Regierung klagt.
b) Andererseits werden Formen dort, wo die tiefere Einsicht fehlt, ohne Sinn und Verstand und ohne eigene Durchdringung kopiert und weiter und weiter kopiert, bis aller Sinn aus ihnen gewichen
ist; ähnlich wie bei einem Schriftstück, das man hundert und tausend Mal durch den Kopierer jagt, bis kein sinnvoller Text mehr zu entziffern ist.
Beide Gefahren entspringen mangelnder Kenntnis. Immer noch haben die wenigsten die Kunst als solche von einem Meister kennen gelernt. Wir haben unsere Bedenken schon angedeutet, dass sich dieser
Kenntnismangel gerade durch Versuche institutioneller Qualitätssicherung ausbreiten könnte. Wer Fachzeitschriften aufblättert, bekommt unweigerlich seitenweise sogenannte „Lehrerausbildungen“
angeboten – als handele es sich beim Taijiquan um einen Lehrberuf und nicht um etwas, was zu seiner Meisterung viele Jahre der Schülerzeit bei einem Meister bedürfte.
Mit diesen „Lehrerausbildungen“ lassen sich zwar Jubelstatistiken erstellen, die die Ausbreitung des Taiji belegen – aber um welchen Preis? Solche „Ausbildungen“ werden oft genug von Leuten
angeboten, die selbst nie von einem Meister autorisiert wurden. Vor allem werden sie Unbekannten gegen Geld angeboten und nicht Schülern, gegenüber denen man Verantwortung trägt; Unbekannten, die
ihrerseits dem „Ausbilder“ gegenüber nicht das Vertrauen eines Schülers und den Respekt vor der Überlieferung haben.
Die Welt des Taiji ist also durchaus nicht frei von Anmaßung, Institutionalisierung, Vereinspolitik und Geschäftemacherei. Wie soll man darauf reagieren? Die Antwort ist: Taiji-gemäß, d.h. durch
wuwei. Wuwei ist ein Zentralbegriff der daoistischen Philosophie, die im Taiji eine große Rolle spielt. Man übersetzt ihn gerne mit „Handeln durch Nicht-Handeln“. Statt sich selbst auf Graben-
und Fraktionskämpfe einzulassen, gilt es einzusehen, dass all das nicht „schlecht“ ist, sondern schlicht so ist, wie es ist. Wir werden alle unter unvollkommenen Bedingungen auf den Weg gebracht;
auf den Weg, der nach den Quellen sucht; nach Quellen, die bei jedem wahren Meister entspringen; nach Quellen, die man finden wird, wenn man aufrichtig nach ihnen sucht.
IV.
Was also sucht man auf dem Weg des Taijiquan? Entspannung, Gesundheit oder die höheren Weihen der Selbstverteidigung? Man hört es häufig, dass jemand sagt: „Ich betreibe es nur der Entspannung
halber (oder der Gesundheit wegen).“
a) Aber ist das ein Grund, es nicht richtig zu machen? Was der Gesundheit dient, ist schließlich genau die Art von Entspannung und Durchlässigkeit, die im Taijiquan als Methode einer Kampfkunst
entdeckt wurde. Wer diese Dimension nicht anstrebt, wird auch nicht in den Genuss der spezifischen gesundheitsfördernden Wirkung des Taiji kommen.
b) Wer aber Taiji als Kampfkunst lernen will, um damit kämpfen zu können, liegt u. U. noch weiter daneben. Bis er jene sagenhaften Fähigkeiten erlangt hat, die man mitunter bei alten Meister
sehen kann, hat er seine Kämpfe längst verloren – oder es steht ihm gar nicht mehr der Sinn nach Kampf.
Es gibt zwar Schlimmeres, als Dinge zu tun, weil man sich von ihnen eine gesundheitsfördernde Wirkung verspricht; oder weil man eine Kampfkunst erlernen will, bei der das Sanfte den Sieg über
rohe Gewalt davonträgt. Dennoch möchte ich für einen anderen Zugang zum Taiji plädieren: dass man es nämlich um seiner selbst willen tut; d.h. dass man sich ihm nicht wie einer instrumentellen
Angelegenheit nähert; dass man es nicht als etwas tut, um damit etwas anderes zu erreichen. Dann erst versteht man das Taiji als Kunst. Die so verstandene Kunst ähnelt einem Spiel, das ebenfalls
seinen Zweck in sich selbst und nicht außerhalb seiner hat. Und beides – Kunst und Spiel – ähnelte dem Leben, wie es Aristoteles verstanden hatte: nämlich als eine Tätigkeit, die man „um ihrer
selbst willen“ tut und nicht um eines außerhalb ihrer liegenden Zweckes. Am Ende könnte das Taiji auch so etwas wie ein chinesischer Umweg sein, uns in einer Zeit, die alles auf einen Nutzen hin
verrechnen will, auf alte europäische Einsichten zu stoßen.
Wer das Glück hatte, einen alten Meister zu erleben, der nach 40-, 50-jähriger Übungspraxis eine Taiji-Form mit einer Geschmeidigkeit und Leichtigkeit läuft, wie man sie von keinem Jüngeren sehen
kann, und der in Partnerübungen junge, kräftige Männer mit spielerischer Leichtigkeit durch die Gegend wirbeln kann – und das so, dass es allen Vergnügen bereitet und niemand verletzt wird, weder
äußerlich noch innerlich –, der fragt nicht nach Sinn und Zweck der Kunst, sondern möchte sie selbst meistern lernen.
Könnte man bei einem solchen Meister lernen, wäre das ein unschätzbares Glück, denn: „Taiji lernen ist einfach – Fehler korrigieren ist schwer.“ Wo aber findet man diese Meister? Selbst in China
oder Taiwan findet man sie nicht wie Sand am Meer. Ihn zu finden, hängt für Chinesen von yuan fen ab, ist Schicksal oder Bestimmung. Je ernsthafter wir üben, desto näher kommen wir diesen
Meistern. Jeder findet den Lehrer, den er verdient.
Ernsthaft heißt übrigens nicht: ohne Spaß an der Sache, im Gegenteil. Ernsthaft heißt: den Schatz finden wollen. Den Schatz, der uns teilhaben lässt an einer Überlieferung, die an jedem Ort und
zu jeder Zeit ein bisschen anders aussieht; aber immer mit der Hoffnung, dass nichts verloren ging. Damit leistet Taiji in unserer hektischen Zeit neben der Erinnerung an die Ruhe, die in seinen
langsamen Übungsformen liegt, noch etwas Grundlegendes: Es bringt uns den Sinn von Überlieferung als solcher nahe. Noch immer fragen wir bei allen passenden und unpassenden Gelegenheiten: Wer hat
was zuerst erfunden? – und vergessen darüber, dass eine andere Frage vielleicht schon wieder viel wichtiger geworden ist: Wer hat sich wie lange an etwas erinnern können?
Taiji ist das lebendige Gedächtnis einer großen chinesischen Weisheit: dass rohe Kraft mit Sanftheit neutralisiert werden kann und dass alles seinen Ausgleich findet. Taiji heißt daher auch, sich
an Unangenehmes, so weit nötig, anpassen zu können, Angriffe zu neutralisieren, mit welcher Wucht und aus welcher Richtung sie auch immer kommen mögen. In diesem Sinne möchte ich sagen: Taiji
wird auch seine Verbreitung überleben. Es liegt an uns, wir können sie mit gestalten. Wir können ihr den Sinn der Besinnung geben und in ihr den Wert der Wahrung von Quellen erkennen. Taiji ist
ein unendlicher Weg, aber schon bei den ersten Schritten auf ihm können wir Wunderbares erleben. Und so ist es kein Wunder, dass selbst jene, die es vielleicht nur mit der Intention beginnen,
etwas Nützliches für sich zu tun, dabei bleiben und es ihnen zur Passion wird, einfach weil es eine der schönsten Beschäftigungen ist, die diese Welt zu bieten hat.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen noch viel Freude beim Üben hier und heute – wann und wo auch immer hier und heute für Sie sein wird.